Playlist #428 vom 27.07.2025 - WONG KAR-WAI Special
Laut einer Umfrage von „Sight and Sound“ im Jahr 2002
belegte der Hongkonger Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent Wong
Kar-Wai bei einer Umfrage zu den größten Filmemachern der letzten 25 Jahre
den dritten Platz. Tatsächlich zählen seine Werke seit seinem Debüt „As
Tears Go By“ (1988) regelmäßig zu den besten internationalen Filmen und
zeichnen sich durch eine nichtlineare Erzählweise, atmosphärische Musik und
lebendige Kinematographie mit kräftigen, satten Farben aus. Auch wenn er bei
der Verleihung der Oscars bislang stets ignoriert worden ist, hat er für seine
Filme wie „Glücklich vereint“, „2046 – Der ultimative Liebesfilm“, „Der
Klang der Liebe“ und „The Grandmaster“ doch etliche internationale
Filmpreise eingeheimst.
Wong Kar-Wai wurde am 17. Juli 1958 in Shanghai als jüngstes
von drei Geschwistern geboren. Sein Vater war Seemann, seine Mutter Hausfrau. Als
Wong fünf Jahre alt war, begannen die Keime der Kulturrevolution in
China zu wirken, und seine Eltern beschlossen, nach Hongkong umzuziehen. Die
beiden älteren Kinder sollten später nachkommen, doch die Grenzen schlossen,
bevor sie dazu Gelegenheit hatten, und Wong sah seine Geschwister zehn Jahre
lang nicht wieder. In Hongkong ließ sich die Familie in Tsim Sha Tsui nieder,
und sein Vater arbeitete als Manager eines Nachtclubs. Als Einzelkind in einer
neuen Stadt fühlte sich Wong in seiner Kindheit isoliert. Er hatte Mühe,
Kantonesisch und Englisch zu lernen und sprach diese neuen Sprachen erst als
Teenager fließend.
Als Jugendlicher nahm seine Mutter Wong oft mit ins
Kino und sah dort eine Vielzahl von Filmen. Später sagte er: „Mein einziges
Hobby als Kind war das Anschauen von Filmen.“ 1980 studierte er Grafikdesign am
Hong Kong Polytechnic, brach das Studium jedoch ab, nachdem er zu einem
Ausbildungskurs beim Fernsehsender TVB angenommen worden war, wo er als Produktionsassistent
arbeitete.
Bald begann er eine Karriere als Drehbuchautor, zunächst für
eine Hongkonger Lokalserie und Seifenopern wie „Wenn die Gondeln Trauer
tragen“ (1981), bevor er sich dem Schreiben von Filmdrehbüchern zuwandte. Er
arbeitete im Team und verfasste Beiträge für verschiedene Genres, darunter
Liebesfilme, Komödien, Thriller und Krimis, konnte sich aber wenig für diese
frühen Projekte begeistern, die der Filmwissenschaftler Gary Bettinson
als „gelegentlich kurzweilig und meist entbehrlich“ beschrieb. Dennoch schrieb er
in den 1980er Jahren weiter an Filmen wie „Just for Fun“ (1983), „Rosa“
(1986) und „The Haunted Cop Shop of Horrors“ (1987). Wong
verbrachte zwei Jahre damit, das Drehbuch für Patrick Tams Actionfilm „Final
Victory“ (1987) zu schreiben, für den er bei den 7. Hong Kong Film Awards
nominiert wurde.
1987 erreichte die Hongkonger Filmindustrie ihren Höhepunkt
und erfreute sich eines beachtlichen Wohlstands und hoher Produktivität. Um
diesen Erfolg aufrechtzuerhalten, wurden neue Regisseure benötigt. Dank seiner
Verbindungen in der Branche wurde Wong eingeladen, Partner der neuen
unabhängigen Firma In-Gear zu werden und seinen eigenen Film zu drehen.
Als John Woo 1986 mit „A Better Tomorrow“
begann, Geschichten aus dem chinesischen Mafiamilieu mit Themen um
traditionelle chinesische Werte wie Treue, Ehre und Freundschaft zu erzählen
und dabei sowohl brutale Gewalt als auch eine bis zur Kitschgrenze anmutende
Emotionalität zu verbinden, war das zugleich die Geburtsstunde des sogenannten
Actionfilm-Subgenres „Heroic Bloodshed“. Vor diesem Hintergrund, aber auch
unter Berücksichtigung der Vorbilder Sam Peckinpah („Wer Gewalt sät“,
„Getaway“) und Martin Scorsese („Hexenkessel“) entstand Wong
Kar-Wais Erstlingswerk „As Tears Go By“. Der Film beschreibt das
Wechselbad der Gefühle, das der kompromisslose Tiraden-Ausputzer Wah durchlebt,
wenn er einerseits seinem allzu naiven und sorglosen Fly immer wieder beistehen
muss, andererseits aber zunehmend stärkere Gefühle für seine Cousine entwickelt,
es aber nicht schafft, ein Leben jenseits von Gewalt und Verbrechen zu führen.
Zwar spielt sich die Gangster-Geschichte in konventionellen Bahnen ab und wird
von dem Wechselspiel von gegenseitigen Angriffen zwischen den beiden
Alphamännchen der Tirade vorangetrieben, doch demonstriert Kar-Wai in
den Kampfszenen bereits seinen eigenen Stil, wenn er sie in Zeitlupe und mit
niedriger Bildrate inszeniert und dabei immer wieder interessante Perspektiven
findet, die aus den Nahkämpfen und Schießereien kleine Kunstwerke machen. Die
Liebesgeschichte zwischen Wah und Ngor kommt dabei leider etwas kurz, aber
gerade diese Art von Geschichten sollen die nachfolgenden Werke von Kar-Wai
prägen. Vor allem die stilisierte Farbgebung mit grellen Großstadtfarben
verleihen der Mischung aus Film noir, Nouvelle Vague, Hongkong-Action und
Liebesdrama ihren besonderen Reiz, aber auch die Chemie zwischen dem ehemaligen
Model Maggie Cheung und Andy Lau funktioniert bestens.
Kar-Wais zweiter Film „Days of Being Wild“
(1990) markierte auch den Beginn der langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem
Autorenfilmer und dem australischen, dem Hongkong-Kino eng verbundenen
Kameramann Christopher Doyle, der fortan den magischen Look von Kar-Wais
Werken prägen sollte.
Mit „Days of Being Wild“ hat Wong Kar-Wai
versucht, das Hongkong seiner Kindheit wiederzubeleben, wozu sein neuer
Kameramann Christopher Doyle („Paranoid Park“, „The Limits of
Control“) die passenden Bilder kreiert hat. Kar-Wais zweiter Film
darf als Blaupause für nahezu alle weiteren Werke des Ausnahmeregisseurs
betrachtet werden, legt er hier doch den Grundstein für episodenhaft
zusammengesetzte Geschichte zwischen Figuren, die immer mal wieder auch in
späteren Filmen wieder auftauchen, manchmal mit dem gleichen Namen wie
beispielsweise Li-zhen, der wir – wiederum von Maggie Cheung verkörpert
– in „In the Mood for Love“ wiederbegegnen. Der Plot wird zwar von
Yuddys Suche nach seiner wirklichen Mutter vorangetrieben, doch um dieses eher
sporadisch verfolgtes Ansinnen herum thematisiert „Days of Being Wild“
vor allem die (oft vergebliche) Suche der Figuren nach Liebe. Dabei spielen
immer wieder auftauchende Motive wie Gitter, Uhren und Regen ebenso eine Rolle
wie das melancholische Gefühl der Isolation, was durch die monochromatisch
grüne Farbgebung, die regenfeuchten Nächte und die eingeschränkten Blickwinkel
von Großaufnahmen und Halbnahdarstellungen noch verstärkt wird. Wong
Kar-Wais zweiter Film verzaubert weniger durch die ziellos wirkenden
Romanzen als durch das Zusammenspiel von symbolträchtigen Bildern und
stimmungsvoller Musik in einem nostalgisch anmutenden Drama ohne Happy End. Die
eigentlich geplante Fortsetzung wurde nicht realisiert, da sich „Days of
Being Wild“ als Flop erwies und die Zusammenarbeit zwischen Wong Kar-Wai
und Produzent Alan Tang beendete.Nachdem Wong Kar-Wai mit seinen ersten beiden Filmen „As
Tears Go By“ (1988) und „Days of Being Wild“ (1990) vor allem Kenner
des Hongkong-Kinos in den Bann zog, gelang dem hippen Autorenfilmer mit seinem
dritten Film „Chungking Express“ (1994) der internationale Durchbruch – Quentin
Tarantino sei Dank! Der besorgte dem Film nämlich mit Miramax einen
weltweiten Vertrieb und erhielt durch Tarantino selbst nicht bezahlbare
Mundpropaganda. Dabei setzte „Chungking Express“ nur die Art des
Filmemachens fort, die Kar-Wai vor allem mit „Days of Being Wild“
als individuellen Stil manifestierte, als eine Collage von Einzelschicksalen
auf der Suche nach Liebe.
Das Konzept der losen, episodenhaften Erzählung gerade aus „Days
of Being Wild“ greift Wong Kar-Wai in „Chungking Express“
noch radikaler auf, stehen nun mit einer von ihren Partnern betrogenen
Drogenschmugglerin, zwei Polizisten, die sich vor allem über ihre Dienstnummern
identifizieren, und eine liebeskranke Imbiss-Angestellte gleich mehrere Figuren
im nicht näher ausgemachten Fokus des Episoden-Reigens. Wong Kar-Wai
scheint sich nicht besonders für sie zu interessieren, gewinnen sie doch in der
losen, weitgehend spannungslosen Erzählung kaum Kontur und bieten wenig
Identifikationspotentiale für die Zuschauer. Es ist vielmehr der audiovisuelle
Stil, der „Chungking Express“ seinen ureigenen Sog verdankt, denn in der
postmodernen Symbiose von Godards Ästhetik bis hin zur
Video-Clip-Ästhetik von MTV bietet Kar-Wais Film ein erneut
melancholisches, aber poetisches Zusammentreffen einsamer, sich nach Liebe
sehnender Menschen, die dem großstädtischen Moloch nicht entfliehen können und
einsam ihren neurotischen Neigungen nachgehen, weil sie die Liebe, selbst wenn
sie bereits in ihren eigenen vier Wänden nistet, nicht wahrnehmen, so sehr sind
sie sich selbst entfremdet.
Spielten sich die ersten drei Werke des seit „Chungking
Express“ auch international gefeierten Regisseurs noch in den dreckigen,
neongrellen und anonymen Vierteln der Großstadt ab, verlegte der selbsternannte
Martial-Arts-Fan Kar-Wai die Kulisse für seinen ebenfalls 1994
entstandenen Film „Ashes of Time“ in die chinesische Wüste. Nachdem das
hastig zu den Filmfestspielen von Venedig fertiggestellte Werk damals an den
Kinokassen floppte, überarbeitete Kar-Wai den Film im Jahr 2008, kürzte den
Film um sieben Minuten und ließ den Score für „Ashes of Time Redux“ komplett
erneuern.
Wong Kar-Wai hat sich als Fan klassischer
chinesischer Martial-Arts-Romane für „Ashes of Time“ von einem Epos des
Journalisten Jin Yong inspirieren lassen, das wie viele seiner Werke als
Fortsetzungsgeschichten in Zeitungen veröffentlicht wurde, so auch das zwischen
1957 und 1959 erschienene „The Legend of the Condor Hero“. Zusammen mit
seinen fest zum Stab gehörenden Kameramann Christopher Doyle und
Produktionsdesigner William Chung inszenierte Kar-Wai einen Film,
das mit klassischen Martial-Arts-Filmen wenig gemein hat, denn im Mittelpunkt
stehen nicht die Kampfszenen, sondern die Schicksale der Figuren, die in loser
Folge in der einsam in der Wüste gelegenen Behausung des
Auftragsmord-Vermittlers Ou-yang Feng auftauchen, der die Episoden mit
Rückblenden und Erinnerungen als Erzähler aus dem Off irgendwie
zusammenzuhalten versucht. Da man über die Komplexität der emotionalen
Verwicklungen aus Begehren, Zurückweisung, Rachedurst, Schmerz und Enttäuschung
schnell den Überblick verliert, dient die vordergründig eingesetzte Musik und
die vertraut ästhetisierten Bilder für den Zusammenhalt. Natürlich sind die
vorwiegend in Gelb-, Grün- und Blautönen gehaltenen Bilder, die gekippten
Horizonte und die ungewöhnlichen Perspektiven gewohnt beeindruckend und von
magischer Schönheit. Durchbrochen wird dieser melancholische Fluss der Bilder
durch die gelegentlichen Kampfszenen, wie durch verschiedene Filter- und
Shutter-Effekte demontiert und zu einer geräuschvollen Collage in
Extremzeitlupe zusammengesetzt werden, die der Ästhetik von Musikvideos sehr
nahekommt. Am Ende erzählt „Ashes of Time“ in vertrackten Episoden von
Liebe und Einsamkeit, von Schmerz und Tod, von Erinnern und Vergessen, von
Zuneigung und Zurückweisung. Schade nur, dass die Figuren bei all der Schönheit
so blass bleiben und wie im Fiebertraum vorüberziehen.
Bereits mit seinen vorangegangenen Filmen hat es sich
Hongkongs Arthouse-Filmer Wong Kar-Wai zur Regel gemacht, eine lose
Anzahl von Figuren zu begleiten, wie sie sich von der Trennung früherer
Geliebter erholen und eine neue Liebe zu finden versuchen, wobei er das Ganze
in neongrellen Farben in ungewöhnlichen Perspektiven und ästhetisierten Montagen
und mit einem dazu passenden Soundtrack verpackte. Sein 1995 entstandener Film „Fallen
Angels“ darf als direkte Fortführung von „Chungking Express“
verstanden werden, war er doch als dritte Episode der beiden im Vorgängerfilm
angedacht, die dann aber bereits Spielfilmlänge eingenommen haben.
Ebenso wie in „Chungking Express“ begleitet Wong
Kar-Wai seine sehr jungen Figuren durch zufällig wirkende Momente ihres
Lebens, lässt sie aufeinander zugehen und wieder abprallen, und wie eine
Flipperkugel betritt nach einem harten Schnitt die nächste Figur die Bühne.
Hier übt niemand einen klassischen Beruf aus, sondern jeder schafft sich aus
der Not heraus sein ganz eigenes Leben. Hier ist der Killer, der aus seiner
Unlust, Entscheidungen zu treffen, froh ist, dass er von seiner Agentin Ort und
Zielpersonen mitgeteilt bekommt und er nur noch den Auftrag ausführen muss. Die
Agentin wiederum droht an der unerwiderten Liebe zu ihm zu zerbrechen,
verschafft sich Zugang zu seiner Wohnung und masturbiert verzweifelt auf dem
Bett ihres Partners, der nicht mehr ihr Partner sein will. Unglücklich verläuft
auch die Liaison zwischen dem stummen Kleinkriminellen Ho Chi Mo und der
hyperaktiven Cherry. Mit Fragmenten wie dem Video, das Ho Chi Mo von seinem
Vater dreht, das dieser sich an seinem 60. Geburtstag vergnügt anschaut, der
blonden Gummipuppe, die er Cherry zum Abreagieren ihrer Rachegefühle gegen
Blondie besorgt, und dem Eiswagen, mit dem er nachts eine ganze Familie durch
Hongkong kutschiert, verleiht Wong Kar-Wai den verzweifelt um Liebe
suchenden Menschen etwas Persönlichkeit. Dabei variiert er zwischen Kitsch und
Action, lässt seinen Haus-Kameramann Christopher Doyle mit greller
Musikclip-Ästhetik ein Tableau bereitstellen, das mit schnellen Schnitten,
extremen Weitwinkelaufnahmen, Zeitraffer und Zeitlupen, Schwarzweiß- und
Stop-Motion-Bildern eine wilde, fieberglänzende Achterbahnfahrt der Gefühle
zeichnet, bei der die Liebe ein kurzes Verfalldatum zu haben scheint.Nach den sehr episodenhaft und stark fragmentiert erzählten
Filmen wie „As Tears Go By“, „Days of Being Wild“ und „Fallen Angels“
ging der mittlerweile durch die Fürsprache von Quentin Tarantino auch
international bewunderte Autorenfilmer mit „Happy Together“ (1997) einen
neuen Weg. Allerdings täuscht der Titel ein Glück vor, das im Leben der beiden
Protagonisten keinen Bestand hat.
Während Wong Kar-Wai in seinen früheren Werken ein
ganzes Ensemble an unterschiedlichen Leuten durch eine wahllos zerstückelte
Handlung führte, wagte er es in „Happy Together“ erstmals, sich auf ein
einziges Liebespaar zu konzentrieren und bei den beiden Protagonisten zu
bleiben. Der irreführende Titel des Films verweist dabei lediglich auf die
Vergangenheit des schwulen Pärchens, von dem wir nicht wissen, wie es sich in
Hongkong kennengelernt und warum es sich auseinandergelebt hat, denn die
Handlung spielt sich vorwiegend im fernen Argentinien ab, wo die Welt nicht
viel anders aussieht als in der Heimat. Obwohl Lai Yiu-Fai und Ho Po-wing
wissen, dass ihre Beziehung zu Ende ist, können sie sie nicht einfach beenden.
Einzelne rauschhafte Glücksmomente, die in der körperlichen Vereinigung und dem
unbelasteten Ausleben ihrer Gefühle erleben, haben offensichtlich ein Band
geknüpft, das sich nicht so einfach zerreißen lässt. Als Zuschauer bemerkt man
jedoch nach wenigen Szenen, dass die Beziehung keine Zukunft hat. Für Lai
genügt schon die Gegenwart eines sympathischen Arbeitskollegen, um sich
gefühlsmäßig neu zu binden. Kar-Wai und sein Stamm-Kameramann Christopher
Doyle begleiten diese toxische Beziehung mit ungewohnt ruhig fließenden
Bildern, die längst nicht so hektisch zusammengeschnitten sind wie in Kar-Wais
früheren Werken. Zwar wechselt sich die vertraut grelle Farbgebung immer mal
wieder mit grobkörnigen Schwarzweiß-Bildern ab, begegnen uns die bekannten
ungewöhnlichen Blickwinkel und Horizontverschiebungen, aber insgesamt wirkt „Happy
Together“ erstmals wie aus einem Guss und macht das Gefühlsleben der
Protagonisten nachvollziehbarer, weil sich Kar-Wai ausnahmslos um sie
kümmert. Das tut dem Film einfach gut und macht ihn zum reifsten und
eindringlichsten Film des Ausnahmeregisseurs.Mit seinem 2000 entstandenen Liebesfilm „In the Mood for
Love“ hat Wong Kar-Wai schließlich sein Meisterstück vorgelegt und
eine ungewöhnlich zarte Liebesgeschichte inszeniert, die an der Unvereinbarkeit
zwischen Wunsch, Tradition und Wirklichkeit auseinanderzubrechen droht, bevor
sie überhaupt begonnen hat.
Bereits mit dem irreführend „Happy Together“
betitelten Vorgängerfilm hat Wong Kar-Wai das Scheitern einer
Liebesbeziehung thematisiert, doch war die Beziehung zwischen den beiden jungen
Männern, die in Argentinien auf eine Wiederbelebung ihrer Liebe gehofft haben,
von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Bei „In the Mood of Love“ sind
die Vorzeichen genau umgekehrt. Hier bahnt sich mit dem gleichzeitigen Einzug
von Chow Mo-wan und Li-zhen in benachbarte Wohnungen erst eine Liebesbeziehung
an. Ihre jeweiligen Ehepartner bekommen wir nie zu sehen, nur zu hören, und im
Verlauf der Geschichte sind sie einfach verschwunden, werden nicht mehr
thematisiert, auch weil es den beiden Betrogenen zu unangenehm ist, voreinander
einzugestehen, dass sie von ihren Partnern so vorgeführt werden.
Interessanterweise stürzen sich die beiden nicht ebenfalls in eine Affäre,
vermeiden es, nicht zum Gegenstand von Getuschel und Gerüchten zu werden. So
warten sie nach einem gemeinsam verbrachten Abend so lange, bis ihre Vermieterfamilien
mit dem Mah-Jongg-Spielen fertig sind und sich zur Ruhe begeben haben, ehe
Li-zhen auf ihr eigenes Zimmer geht. Doch so vertraut und nah miteinander Chow
und Li-zhen auch sind, so sehr sie sich alles anvertrauen und zärtliche Gefühle
füreinander entwickeln, wollen sie doch nicht so treulos wie ihre Partner
agieren, versagen sich so ihr eigenes Glück. Wong Kar-Wai hat diese
unvollkommene Liebesgeschichte einmal mehr mit grandiosen Bildern von Christopher
Doyle (und zwei zusätzlichen Kameraleuten) eingefangen und mit einem
großartigen Soundtrack versehen, aus dem sich das von Shigeru Umebayashi komponierte
„Yumeji’s Theme“ wie ein Leitmotiv durch den Film zieht und von zeitgenössischer
chinesischer Folklore und drei spanischen Liedern von Nat King Cole
ergänzt wird.
Bryan Ferrys Coverversion von „In the Mood fo
Love“ durfte als Titelgeber für den Film fungieren, der den Geist einer
anderen Zeit atmet und die an sich perfekte Beziehung ohne Sex thematisiert.
Das Hotelzimmer mit der Nummer 2046, in dem Chow und Li-zhen ihre
Martial-Arts-Geschichten tauchen ebenso wie Chow und einige Musikstücke im
nachfolgenden Film von Wong Kar-Wai auf: „2046“. In dieser Art
von Fortsetzung verkörpert Tony Leung Chiu-wai erneut die aus dem
Vorgängerfilm bekannte Figur des Journalisten Chow Mo-wan. Und doch ist „2046“
ein ganz anderer Film geworden.
Auch wenn Tony Leung Chiu-wai erneut in der Rolle des
Chow Mo-wan zu sehen ist, verkörpert er doch einen ganz anderen Mann als in „In
the Mood for Love“. War er dort nicht bereit, sich auf eine Beziehung mit Su
Li-zhen (Maggie Cheung) einzulassen, die ebenso wie er selbst von ihrem
Ehepartner betrogen worden ist, hat sich in „2046“ das Blatt komplett
gewendet. Aus dem Journalisten wird nun ein Romanautor, dessen
Science-Fiction-Roman mit dem Titel 2046 sich allerdings recht komplex auf der
Handlungs- und Beziehungsebene gestaltet und immer wieder mit der eigentlichen
Filmhandlung durcheinandergerät. Vor allem ist aus dem zuvor so
zurückhaltenden, zuvorkommenden und höflichen Mann ein Womanizer geworden, der
sich auf keine feste Bindung mehr einlassen will, nachdem seine große Liebe
nicht ausgelebt werden konnte. Wong Kar-Wai eröffnet „2046“ mit
einem virtuos inszenierten Blick in die Zukunft. Wenn in dem grellleuchtenden,
grellbunten Universum nur schemenhaft erkennbare Schnellzüge durch die Szenerie
rasen, fühlt man sich an eine kompaktere Version von Luc Bessons „Das
fünfte Element“ oder ein überbelichtetes Negativ von Ridley Scotts „Blade
Runner“ erinnert. Aber auch die Szenen aus dem Hongkong der 1960er Jahre
sind wie gewohnt von Christopher Doyle (und Pun Leung Kwan)
grandios eingefangen und kreisen wie gewohnt um die Liebe, diesmal um den
Verlust der einzig großen Liebe, die nicht durch andere Beziehungen wieder
erlebt werden kann. Trotz der unübersichtlich verschachtelten Handlungsstränge
und Beziehungsgeflechte macht „2046“ deutlich, wie schwer jeder Liebende
sich mit seinen Gefühlen tut. Das ist im Vergleich zum Meisterwerk „In the
Mood for Love“ unnötig kompliziert fragmentiert worden, doch das Gefühl von
Trauer, Melancholie und Sehnsucht schwingt sich erhaben durch den ganzen Film.
Nachdem Michelangelo Antonioni mit „Jenseits der
Wolken“ (1995) einige Geschichten seines Erzählbandes „Bowling am Tiber“
verfilmt hatte, bekam der armenische, überwiegend in Frankreich arbeitende
Produzent Stéphane Tchalgadjieff die Idee, eine Trilogie rund um den „Eros“,
um Liebe und Begehren, zu realisieren, wobei neben Antonioni noch zwei
Regisseure verpflichtet werden sollten, die Antonioni künstlerisch
nahestanden.
In „The Hand“ erzählt Wong Kar-Wai die
Geschichte des jungen Schneiders Zhang (Chang Chen), der sich in eine
seiner Kundinnen verliebt. Bei dem ersten Besuch in ihrer Wohnung muss er noch
auf Miss Hua (Gong Li) warten, während er im Wohnzimmer durch die dünnen
Wände hört, wie sie gerade Sex mit einem Mann hat. Als er zu ihr ins
Schlafzimmer gebeten wird, kann er seine Erektion nicht verbergen, was Miss Hua
amüsiert, aber auch dazu animiert, ihn die Hosen ausziehen zu lassen und es ihm
mit der Hand zu besorgen. So beschämt Zhang über den Vorfall ist, legt er sich
doch ordentlich ins Zeug, besondere Sorgfalt bei den Kleidern für Miss Hua
walten zu lassen. Er besucht sie auch, als er erfährt, dass sie eine
Prostituierte ist. Als sie krank wird und nicht mehr arbeiten kann, zahlt er
sogar ihre Miete, doch seine Liebe bleibt unerwidert…
Wong Kar-Wai knüpft mit „The Hand“ nahtlos an
seine ästhetisierten Meisterwerke „In the Mood for Love“ und „2046“
an, wobei sein Stammkameramann Christopher Doyle natürlich einen
wesentlichen Anteil hat. Kar-Wai ist auch der einzige Filmemacher des Trios,
der eine sinnliche Geschichte zu erzählen vermag, ohne nackte Haut zu zeigen.
Dafür ist das Zusammenspiel von Chang Chen („Tiger & Dragon“,
„Red Cliff“) mit Gong Li („Rote Laterne“, „Die Geisha“) so
intensiv, dass die Spannung zwischen ihnen spürbar ist und die Dramaturgie der
Handlung entsprechend vorantreibt.
Anschließend beschloss Wong, einen englischsprachigen
Film in Amerika zu drehen, was er später mit den Worten begründete: „Es ist
eine neue Landschaft. Es ist ein neuer Hintergrund, also ist es erfrischend.“ Nachdem
er ein Radiointerview mit der Sängerin Norah Jones gehört hatte,
beschloss er sofort, sie zu kontaktieren, und sie unterschrieb die Hauptrolle. Wongs
Verständnis von Amerika basierte lediglich auf kurzen Besuchen und dem, was er
in Filmen gesehen hatte, doch er war bestrebt, das Land genau darzustellen.
Daher schrieb er den Film gemeinsam mit dem Autor Lawrence Block (einer
der seltenen Fälle, in denen ein Drehbuch im Voraus vorbereitet wurde). Der
Film mit dem Titel „My Blueberry Nights“ handelt von einer jungen New
Yorkerin, die zu einem Roadtrip aufbricht, als sie erfährt, dass ihr Freund
untreu war. Die Figuren, denen sie begegnet, waren Jude Law, Natalie
Portman, Rachel Weisz und David Strathairn.
Die Dreharbeiten zu „My Blueberry Nights“ fanden 2006
über sieben Wochen an Originalschauplätzen in Manhattan, Memphis, Las Vegas und
Ely, Nevada, statt.
Wong produzierte den Film auf die gleiche Weise wie
in Hongkong, und die Themen und der visuelle Stil blieben – obwohl Doyle
durch Kameramann Darius Khondji ersetzt wurde – gleich. „My Blueberry
Nights“ feierte im Mai 2007 Premiere und war Wongs vierter Film in
Folge, der in Cannes um die Goldene Palme konkurrierte. Obwohl er ihn als
„besonderes Erlebnis“ bezeichnete, erhielt der Film keine positiven Kritiken,
obwohl Wong Kar-Wai eine illustre Schar an Schauspielern versammeln
konnte, die sich in dessen stimmungsvoll fotografierten, ruhig inszenierten
Road Movie und Lovestory zu Höchstleistungen angetrieben fühlten. Zusammen mit
dem schönen Soul-/Songwriter-Soundtrack, zu dem Ry Cooder ("Paris,
Texas") einen passenden Score beisteuerte, und den elegant-malerischen
Bildern ist so ein ergreifend-melancholischer Film entstanden, der den
Zuschauer nicht unberührt lassen kann.
Wongs nächster Film wurde erst fünf Jahre später
veröffentlicht, da er eine weitere lange und schwierige Produktion für „The
Grandmaster“ (2013) durchlief – einen biografischen Film über den
Kampfkunstlehrer Ip Man. Die Idee dazu kam ihm bereits 1999, doch er
setzte sie erst nach der Fertigstellung von „My Blueberry Nights“ um.
Bereits 2008 wurde mit „IP Man“ der Anfang gemacht,
die Geschichte des berühmten Kung-Fu-Lehrers IP Man (im Film wird hochchinesische
Pinyin-Aussprache Ye Wen verwendet), der auch Bruce Lee ausbilden
sollte, zu erzählen. Für Wong Kar-Wai dient die Biografie des
außergewöhnlichen Kung-Fu-Kämpfers/Lehrers allerdings nur als Rahmen, um eine
wieder mal unmögliche Liebesgeschichte zu erzählen. Zwar geht Kar-Wai dabei
– bis auf eine wesentliche Rückblende – chronologisch vor und blendet als
Orientierung immer wieder datierte Schrifttafeln ein, die Wendepunkte und
wichtige Ereignisse im Krieg zwischen Japan und China thematisieren, doch zeigt
er sich wenig daran interessiert, alle Stationen in Ye Wens Leben abzureißen.
Und auch wenn „The Grandmaster“ mit einer beeindruckenden Kampfszene
beginnt, in der IP Man im Regen eine ganze Schar von Gegnern zunichtemacht,
ohne auch nur seinen weißen Hut zu verlieren, dienen die auch nachfolgend
kunstvoll in Zeitlupe inszenierten Martial-Arts-Szenen vor allem dazu, die
Anmut und Perfektion der verschiedenen Stile des Kung-Fu zu demonstrieren. Vor
allem der erste, teils in extremer Zeitlupe gefilmte Kampf zwischen IP Man und
Gong Er wirkt dabei wie ein Tanz zwischen zwei Liebenden. Zwar kommen sich die
beiden naturgemäß sehr nahe, aber die hier erwachenden Gefühle bleiben in den
jeweiligen Herzen der Kontrahenten verschlossen. So stellt „The Grandmaster“
ein emotional vielschichtiges, melancholisch-sinnliches Drama dar, das sich
auch Zeit für andere Figuren als IP Man nimmt. So stellt der Kampf zwischen
Gong Er und Ma San am schneebedeckten Bahnsteig vor einem vorbeifahrenden
Schnellzug sogar einen der Höhepunkte des Films dar, der wie gewöhnlich
wunderbar – diesmal ausnahmsweise von Philippe Le Sourd („Sieben
Leben“, „Ein gutes Jahr“) - fotografiert und von Shigeru Umebayashi
und Nathaniel Méchaly stimmungsvoll musikalisch untermalt worden ist.
„The Grandmaster“ wurde im „Slant Magazine“ als Wongs
zugänglichster Film seit seinem Debüt beschrieben und gewann zwölf Hong
Kong Film Awards, darunter in den Kategorien Bester Film und Beste
Regie, und wurde für zwei Oscars nominiert (Kamera und Produktionsdesign). Mit
einem weltweiten Einspielergebnis von 64 Millionen US-Dollar ist er Wongs
bislang erfolgreichster Film.
Seither ist es sehr ruhig um Wong geworden.
Im November 2016 wurde bekannt gegeben, dass er einen
kommenden Film über den Mord an Maurizio Gucci vom vorherigen Regisseur Ridley
Scott übernehmen würde, erklärte jedoch im Oktober 2017, dass er nicht mehr
an dem Projekt beteiligt sei. Im September 2017 erteilte Amazon Video einen
Auftrag zur Serienproduktion von „Tong Wars“, einem Fernsehdrama unter
der Regie von Wong. Es konzentriert sich auf die Bandenkriege im San
Francisco des 19. Jahrhunderts, Amazon stellte die Serie jedoch später ein.
Erst 2023 kehrte Wong mit der Serienproduktion von „Blossoms
Shanghai“ auf die Bildfläche zurück. Sie erzählt die Geschichte eines
Selfmade-Millionärs im Shanghai der 1990er Jahre, der sich von einem jungen
Opportunisten mit schwieriger Vergangenheit zu den Höhen der goldenen Stadt
emporarbeitet.
Zu den wichtigsten Markenzeichen von Wongs Filmen
zählt sein Einsatz von Musik und Popsongs. Er legt großen Wert auf dieses
Element, ist es doch ein zentraler Bestandteil der „narrativen Maschinerie“,
die den Rhythmus des Schnitts bestimmen kann. Vor allem nutzt er die Musik, um
das Gefühl von Geschichte oder Ort zu verstärken. Laut dem Filmwissenschaftler Julian
Stringer erwies sich Musik als „entscheidend für die emotionale und
kognitive Anziehungskraft“ von Wongs Filmen.
Musikalische Wiederholungen werden oft eingesetzt, um
Unausgesprochenes oder Nicht-Ausdrückbares auszudrücken. Das Konzept der
Neuinterpretation wird in zwei von Wongs früheren Filmen besonders
deutlich. David Martinez behauptet, dass Musik der 40er und 50er Jahre
verwendet wird, um die 60er-Jahre in „Days of Being Wild“ wieder
aufleben zu lassen, und eine Filmmusik des Komponisten Frankie Chan,
„inspiriert von Ennio Morricones Spaghetti-Western-Musik“, wird für das
Martial-Arts-Epos „Ashes of Time“ verwendet. In „Chungking Express“
wird Musik eingesetzt, um Emotionen zu wecken und Atmosphäre zu schaffen, aber
auch als Identifikationsmerkmal für die Figur Faye (Faye Wong). Der
1960er-Jahre-Song „California Dreamin’“ von The Mamas and Papas läuft
während der gesamten zweiten Filmhälfte ununterbrochen und wird zu einem
Markenzeichen von Fayes Präsenz in einer Szene. Das Lied ermöglicht ihr nicht
nur, ihre räumlichen und zeitlichen Grenzen zu überschreiten und „repräsentiert
ihren Gemütszustand, sondern betont sie auch als ein Subjekt, das Musik als
Ausdrucks- und Kommunikationsmittel Worten vorzieht“. Insbesondere die
kantonesische Übersetzung westlicher Popsongs ist ein beliebter kultureller Weg
Wongs, wie die kantonesische Version von „Dreams“ von The Cranberries
in „Chungking Express“, Berlins „Take My Breath Away“ in „As
Tears Go By“ und die Neuorchestrierung von „Karmacoma“ von Massive
Attack in „Fallen Angels“ zeigen.
„Es ist diese Bereitschaft, Einflüsse zu übernehmen, neu zu formulieren und auf die Popkultur zu verweisen, die zu Wongs Status als postmoderner Autor beiträgt und seine Filme in ihrer Ausführung sowohl lokal als auch ,transnational‘ macht. Die rhythmische Präsenz in der Konstruktion der Aufnahmen und das Pastiche exzentrischer audiovisueller Reime und Zufälle spielen auch auf Wongs musikalisches Gespür an“, merkt Elizabeth Wright in ihrem Artikel über Wong Kar-Wai auf sensesofcinema.com an. „Wongs ,MTV-Ästhetik‘, die ein Gleichgewicht zwischen Ton und Bild findet, bewahrt eine Sentimentalität, die weder einem ,leeren‘ Spektakel erliegt, noch zulässt, dass sie einem postmodernen Ethos unterworfen wird.“
Filmographie:
1988: As Tears Go By (Wàngjiǎo kǎmén)
1990: Days of Being Wild (Āfēi Zhèngzhuàn)
1994: Chungking Express (Chóngqìng Sēnlín)
1994: Ashes of Time (Dōngxié Xīdú / Dung che
sai duk)
1995: Fallen Angels (Duòluò Tiānshǐ)
1997: Happy Together (Chūnguāng Zhà Xiè)
2000: In the Mood for Love (Huāyàng Niánhuá)
2004: 2046
2004: Eros (Episode „The Hand“)
2007: My Blueberry Nights
2008: Ashes of Time Redux
2013: The Grandmaster (Yī Dài Zōngshī)
2023-2024: Blossoms Shanghai (TV-Serie, 30 Folgen)
Playlist:
02. Frankie Chan & Roel A. Garcia - Sensuous Forest (Chungking Express) - 03:18
03. Frankie Chan & Roel A. Garcia - The Killer #2 (Fallen Angels) - 03:32
04. 陳洪 & 蔣文躍 - 繁花無憂 (Blossoms Shanghai) - 04:34
05. Frankie Chan & Roel A. Garcia - Love Theme (Ashes of Time Redux) - 04:38
06. Peer Raben - Slow Dance for Lover 2 (The Hand) - 03:09
07. Frankie Chan - 曾經上海 II (Blossoms Shanghai) - 03:21
08. Xavier Cugat - Perfidia (Days of Being Wild) - 02:56
09. Michael Galasso - Gun (In the Mood for Love) - 04:03
10. Frankie Chan & Roel A. Garcia - Day of Anger (Ashes of Time Redux) - 03:21
11. Peer Raben - Sisyphos at Work (2046) - 04:51
12. Shigeru Umebayashi - Long Journey (2046) - 04:01
13. Ennio Morricone - Deborah's Theme from Once Upon a Time in America (The Grandmaster) - 03:32
14. Ry Cooder - Ely Nevada (My Blueberry Nights) - 02:31
15. Gustavo Santaolalla - Pajaros (My Blueberry Nights) - 02:22
16. Frankie Chan & Roel A. Garcia - Rain, Tears, and Sweat (Chungking Express) - 05:08
17. Peer Raben - Good Times Bad Times (The Hand) - 04:41
18. Nathaniel Méchaly - Love Theme II (Blossoms Shanghai) - 03:32
19. Ry Cooder - Bus Ride (My Blueberry Nights) - 02:58
20. Frankie Chan & Roel A. Garcia - The Killer's Career (Ashes of Time Redux) - 04:06
21. Frankie Chan - 繁花之深圳 (Blossoms Shanghai) - 03:02
22. Shigeru Umebayashi - Love Theme II (The Grandmaster) - 03:54
23. Ry Cooder - Long Ride (My Blueberry Nights) - 03:13
24. Michael Galasso - Blue (In the Mood for Love) - 05:44
25. Frankie Chan & Roel A. Garcia - Night Snack (Chungking Express) - 05:10
26. Shigeru Umebayashi - Manchuria Express (The Grandmaster) - 03:18
27. Shigeru Umebayashi - Main Theme (2046) - 04:41
28. Frankie Chan - 黃河路落幕 (Blossoms Shanghai) - 03:50
29. Xavier Cugat - Jungle Drums (Days of Being Wild) - 02:30
30. Astor Piazzolla - Milonga for Three (Happy Together) - 05:59


















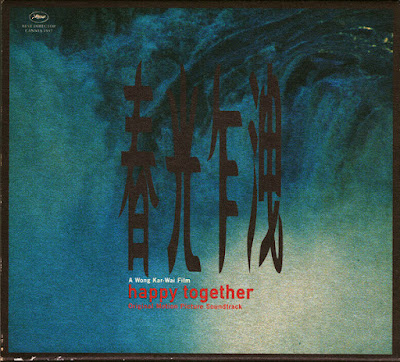


%20%5BJet%20Tone%5D.jpg)



%20%5BUniversal%5D.jpg)









